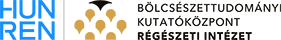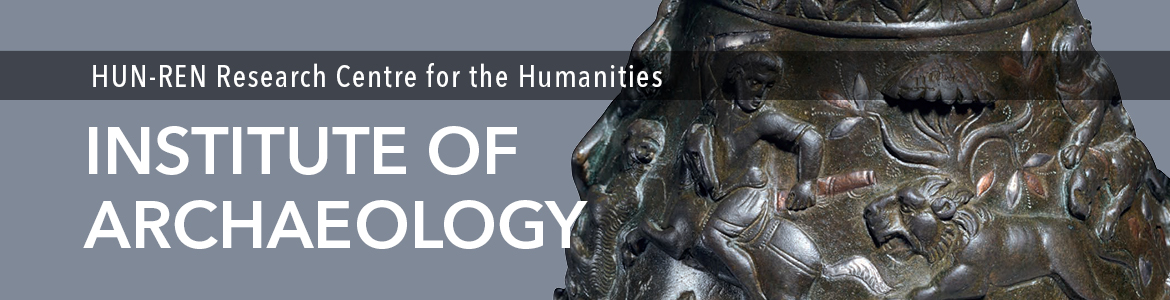stamped pottery, stamped decoration, cylinder seal, late medieval period, 15th–16th century, Western Hungary, Central Transdanubia
![]()
|
Late medieval ceramics with stamped decoration in Central Transdanubia Bianka Gina Kovács 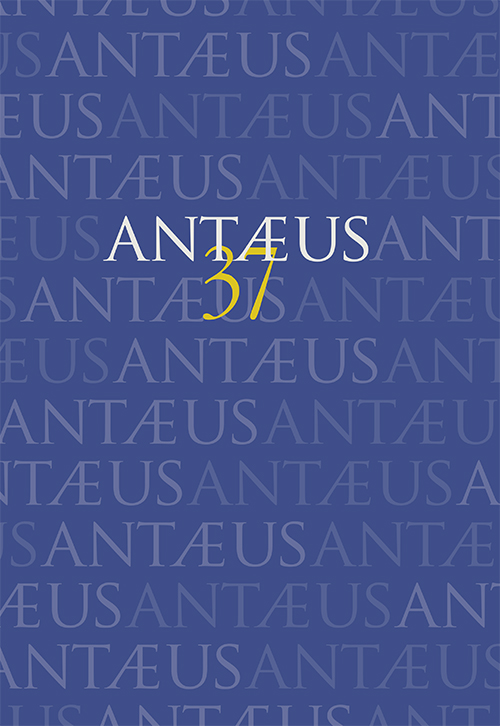
ZusammenfassungDie mitteltransdanubischen, auf der Schulter mit Rundstempeln verzierten Töpfe aus dem Zentralgebiet des einstigen Ungarischen Königreiches gehörten in erster Linie zu den charakteristischen Produkten jener Töpferei, die im Spätmittelalter gelbliche Keramik herstellten. In der Region des Vértes-Gebirges ist auf jeden Fall mit ihrer Produktion zu rechnen, allerdings könnten sie auch in der Umgebung von Buda hergestellt worden sein. Anhand der bisherigen Daten sind sie um Buda seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im Vértes-Gebirge seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts belegbar. Ihre Produktion kann bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nachgewiesen werden. Anhand der Stempelmuster sind Kontakte zwischen mehreren Fundorten belegen zu können. Auf dem Untersuchungsgebiet kommen Exemplare aus rotgebranntem Ton in weitaus geringerer Zahl zum Vorschein, bei denen es sich womöglich um die minderwertigeren Nachahmungen der gelben Stücke handelt. Das stempelverzierte Tafelgeschirr wurde allerdings auf einem weitaus größeren Gebiet produziert: Die Budaer Zierkeramik und ihre Nachahmungen waren in Nordost-Transdanubien, während die roten Exemplare in der Region Nordwest-Transdanubiens verbreitetet, ihre Herstellungsorte sind ebenfalls auf diesem Territorium zu suchen. Darüber hinaus geht man bei den wenigen grauen Stücken von österreichischem Ursprung aus. |
|
The research history of early modern pottery in Hungary Ágnes Kolláth 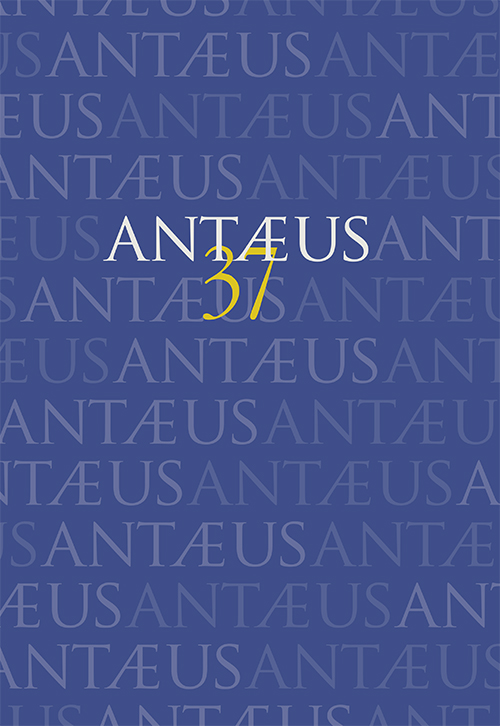
ZusammenfassungZiel der Studie ist die Zusammenfassung der ungarischen Forschungsgeschichte, die sich der frühneuzeitlichen Keramik während der Türkenherrschaft, und der charakteristischen und sehr vielfältigen Palette an Keramiktypen des einstigen Ungarischen Königreichs widmet. Die Forschungsarbeit dieses Keramikmaterials hatte bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen, jedoch blieb das Interesse am Thema bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts eher verhalten, weshalb sich im Allgemeinen nur wenige Forscher – die mitunter über grundlegend verschiedene professionelle Hintergründe verfügten – gleichzeitig damit beschäftigten. Deshalb sind sowohl Denkansätze, als auch die Thematik ihrer Werke sehr vielseitig. Die Studie widmet sich den wichtigsten Warengruppen der Keramik und geht auf die Ergebnisse der letzten 120 Jahre, einer lockeren Zeitordnung folgend und anhand der ersten publizierten Abhandlung über das Thema ein. Sie bespricht österreichische unglasierte und osmanische glasierte Keramik, die grauen und roten unglasierten Tafelgeschirre, die über weitverzweigte Wurzeln verfügen, die südslawischen, handgeformten und/oder mit der handgedrehten Keramiktypen, nahöstliche Fayence und chinesisches Porzellan, Habaner Gefäße mit Bleiglasur, sowie weitere, importierte oder lokal gefertigte Tafelware. Außerdem summiert sie kurz die Ergebnisse bisheriger, regionaler Bearbeitungen und bietet so einen Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten. Schließlich muss allerdings betont werden, dass sich die vorliegende Abhandlung nicht mit Gebäudekeramik, Kachelofen-Elementen, bzw. Pfeifen beschäftigt, da diese Gegenstände über eigene Forschungsgeschichten verfügen, die das Gebiet von Koch- und Tafelgefäßen nur in wenigen Punkten berühren. |
|
Gussform eines türkisch-balkanischen Kopfschmuckes von Lenti-Előhegy (Komitat Zala, SW-Ungarn) Béla Miklós Szőke 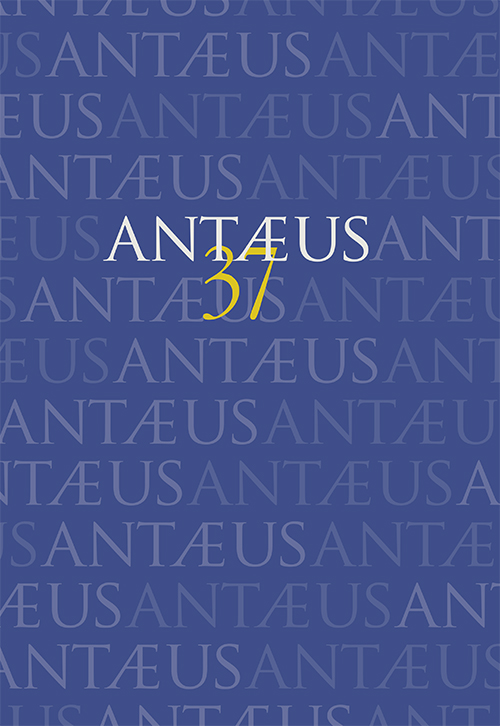
AbstractThe mold of a trinket common among the Balkan population during the Ottoman rule, which also proves its local manufacturing. |
|
Stoves in the Ottoman castle at Barcs, Drava valley, Hungary Gyöngyi Kovács 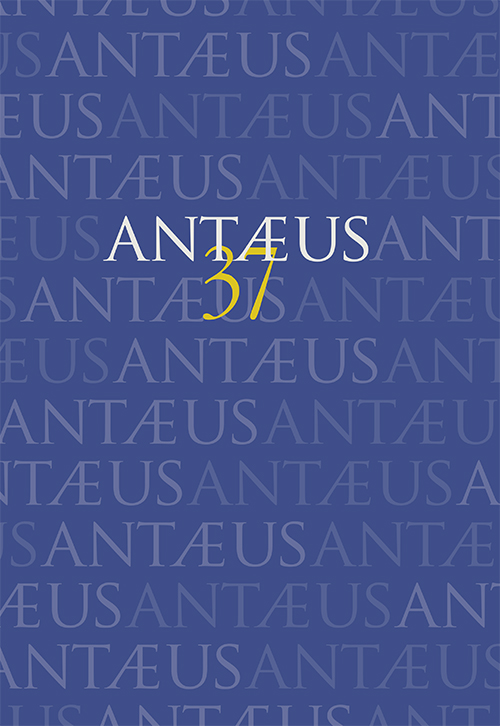
ZusammenfassungVorliegender Beitrag widmet sich den Ofen- und Herdüberresten, bzw. Feuerstellenbestandteilen, die im Rahmen der osmanisch-türkischen Palisadenausgrabung bei Barcs, in der Drauregion zum Vorschein kamen, in einem breiteren historischen, archäologischen und völkerkundlichen Kontext. Die Palisade wurde 1567 erbaut und 1664 zerstört. Das während der Ausgrabungsarbeiten zutage geförderte Fundmaterial lieferte eine Vielzahl an Informationen über die Heizungsarten der Wohnräume, die Orte, Gegenstände und Arten des Kochens und der Lebensmittelzubereitung, außerdem über das Fortleben und die Vermischung von Traditionen. Die große Anzahl an Öfen und Herden hängt mit den klimatischen Verhältnissen („kleine Eiszeit“) der damaligen Zeit zusammen. |
|
Fish consumption in the archiepiscopal residence of Esztergom in the context of fishing, aquaculture and cuisine László Bartosiewicz 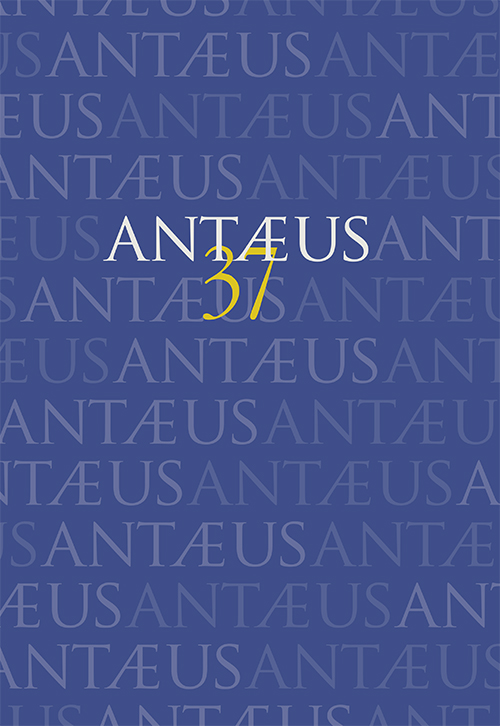
ZusammenfassungDer Fischverzehr spielte in der mittelalterlichen Ernährung eine besonders wichtige Rolle. Daher befassten wir uns im Rahmen der Auswertung jener Küchenabfälle, die aus der Residenz des Erzbischofs zu Esztergom stammten, verstärkt mit der gründlichen Analyse von Fischüberresten. Unser Ziel war es, die Artenzusammensetzung der in der Residenz verzehrten Fische zu bestimmen und ihre Körperlänge zu schätzen. Besondere Stärke der Forschungsarbeit ist, dass das komplette Material mithilfe der Schlämmanalyse aufgedeckt wurde. Dieser Methode ist es zu verdanken, dass wir nun zum ersten Mal in der Geschichte der ungarischen mittelalterlichen Archäologie ein differenziertes Bild über die Nutzung von Fischen erstellen konnten. Im Fundmaterial des 14. und 15. Jahrhunderts fällt die Zunahme des Anteils kleiner Karpfenfische auf, was auf einen Ursprung aus Teichwirtschaften hinweisen könnte. Auch das Vorkommen meist kleiner (junger) Hechte entspricht diesem Umstand. Der Anteil von Hausenüberresten im Fundmaterial ist auffälligerweise unbedeutend, obwohl mehrere Aufzeichnungen auf Hausenfang auf dem Gebiet des Erzbischofssitzes hinweisen. Ein Vergleich der sehr sorgfältig freigelegten Fischüberreste und der schriftlichen Quellen wird uns bei der differenzierten Auslegung dieser Phänomene behilflich sein. |